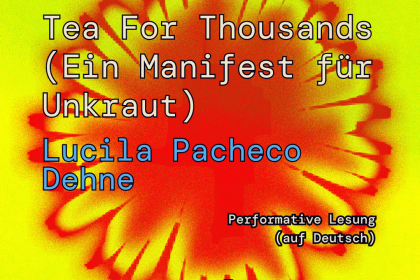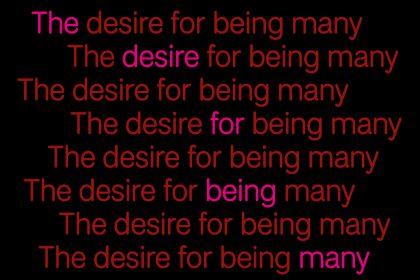to slip, to slide, to glitch verhandelt in einer raumgreifenden Installation mit Videoarbeiten, Textilien, Text und skulpturalen Elementen Momente der Kontrolle, Störung, Zerstörung und Wiederherstellung in der Produktion von Landschaften des sogenannten grünen Kapitalismus.
Dabei werden Unterbrechungen bzw. Glitches (Fehler; Störungen), wie sie beispielsweise in fehlerhaften Satellitenbildern von Tagebauen zu finden sind, als Ausdruck von Unterbrechungen in Landschaften im weitesten Sinne verstanden – mit ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf alle Körper vor Ort, etwa wie die von Menschen, Tieren, Pflanzen, oder Wasser.
Ausgangspunkte der künstlerischen Recherche von Larisa Crunţeanu und Sonja Hornung sind (Post-)Bergbaulandschaften in Ostdeutschland und in Rumänien. Gemeinsam untersuchen sie, inwieweit der Wunsch nach ökologischer und gerechter Transformation mit fortlaufenden Extraktionsprozessen kollidiert. Wer profitiert von dem Wunsch nach Wandel und Wiederherstellung und wie wirkt sich dieser wiederholt zum Nachteil von Menschen und Ökosystemen aus?
Eine Reihe großformatiger textiler Cyanotypien und verschiedene hyperfarbige, artifizielle Pflanzenarten, die zur Rekultivierung ehemaliger Bergbaulandschaften verwendet werden, verwandeln den Galerieraum in eine künstliche Waldlandschaft. In einer in die Installation eingebetteten Videoarbeit, bewegen sich die Künstlerinnen als forschende Protagonistinnen suchend, staunend und beobachtend durch (post-)industrielle Kohlebergbaulandschaften in der Lausitz und durch ein Kupferabbaugebiet im Apuseni-Gebirge. Sich in Skelette verwandelnd verweisen sie auf das Toxische der Szenarien und Prozesse und reagieren zugleich spielerisch auf die eigene destabilisierte Körperlichkeit in der „artifiziellen Natur“. Diese Arbeiten werden durch textbasierte Werke kontextualisiert.
to slip, to slide, to glitch veruneindeutlicht Vorstellungen von Natur und Künstlichkeit, denn Landschaft wird immer auch von Menschen produziert: hier entweder durch die Imagination einer vollständigen Wiederherstellung oder durch tatsächliche Vernachlässigung. Hyperbunte Algen und orangefarbenes, mit Eisensulfaten versetztes Wasser, werden zu den spektakulären Symptomen einer anhaltenden ökologischen Katastrophe. Gleichzeitig widmet sich das Projekt der produktiven Kraft, die entsteht, wenn wir „natürliche“ und „künstliche“ Zustände nicht als voneinander getrennt betrachten. Es verweist auf die Dringlichkeit von Praktiken, die es vermögen, die Wunden der Welt wahrzunehmen und die Verantwortung für Letztere, so wie sie ist, zu übernehmen.
Larisa Crunțeanus Praxis als Performerin, Videokünstlerin und Sammlerin von Sounds bewegt sich zwischen Realität und Fiktion – in einem endlosen Gespräch mit den Betrachtenden. Ihre Arbeiten schaffen Kontexte, in denen Fakten und Erinnerungen reaktiviert werden, was zur Entstehung neuer Praktiken anregt. Viele ihrer Projekte befassen sich mit dem Begriff der Zusammenarbeit und den Ideen, die hinter Objekten und Geschichten stehen.
Sonja Hornungs künstlerische Praxis geht von den Krisen aus, die durch Formen privaten Eigentums und der steigenden Rolle des Finanziellen
und des Geldes im Alltag ausgelöst werden, und untersucht, wie sich diese auf die Beziehung zwischen Körpern und Räumen auswirken.
Neben der Zusammenarbeit mit Larisa Crunțeanu ist das kollektive Arbeiten, beispielsweise mit dem Künstler Daniele Tognozzi oder dem Kollektiv x-embassy, ein wichtiger Bestandteil ihrer Praxis.
Sonjas und Larisas künstlerische Zusammenarbeit begann 2015 mit dem Werk Femina subtetrix. Im Laufe der Jahre fl ossen thematische Fädenaus Femina subtetrix in ihre individuellen künstlerischen Praktiken ein und wurden in späteren Kollaborationen wieder aufgegriffen – darunter die Art und Weise, wie weiblich gegenderte Körper die Produktion unserer eigenen Bilder in privatisierten Räumen verhandeln, und wie die Macht von Camouflage, die Grenzen zwischen „natürlich“ und „künstlich“
aufhebt.
Programm
After Exhaustion
Filmscreenings // 12.6.2024 // 19:00
Die filmischen Arbeiten bewegen sich zwischen Maritza Iztok in Bulgarien, Sachsen und Thüringen in Deutschland und dem Territorium der Indigenen Wayuu im Norden Kolumbiens. Sie untersuchen die verordneten „top-down“ Vorstellungen von Kontrolle, die sich in Kriegstechnologien sowie Technologien für Ausgrabungen materialisieren. Nach und trotz der Ausbeutung bergen Bilder, Land und Körper immer noch hartnäckige Gegenmythen.
Nature Morte, Nikola Stoyanov, 2023 (5:20)
Sonne Unter Tage, Mareike Bernien & Alex Gerbaulet, 2022 (39:00)
Ausschnitte von El Leon Durmiente, Tama Ruß, 2024 (31:00)
Im Anschluss Gespräch mit Tama Ruß & Alex Gerbaulet
Other Transitions
Filmscreenings // 13.6.2024 // 19:00
Bäume, die berühmt werden wollen, ein*e Telefonsexarbeiter* in in Vetagrande Zacatecas, Mexiko, und animierte Gesangskanarienvögel, sogenannte Harzer Roller, auf Teneriffa gehen einem Untergrundgespräch über Momente des Wandels voraus. Diese Videoarbeiten stellen die Kategorien Mensch, Natur und Künstlichkeit auf den Kopf und verweisen auf Momente der Unbestimmtheit, der Verweigerung und der Verfolgung kollektiver Träume gegen alle Widrigkeiten.
Congratulations! You are still in the running for becoming, Ann Oren, 2015 (10:22)
Heavy Blood, Naomi Rincón-Gallardo, 2018 (18:43)
Ausschnitte aus Des Goldes Klang (Golden Tone), Barbara Marcel, 2023 (ca. 40:00)
Im Anschluss Gespräch mit Barbara Marcel (online)
Finissage mit Artist Talk & Open Exchange
12.7.2024 // 19:00
Kurz nach der Eröffnung der Ausstellung to slip, to slide, to glitch genehmigte die Europäische Kommission das Angebot der deutschen Regierung an die Leag – das Unternehmen, das für den Braunkohleabbau in der Lausitz verantwortlich ist – in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro als Kompensation für die Schließung ihres Tagebaubetriebs bis 2038 im Rahmen des „grünen Strukturwandels“. Im Gegenzug soll die Leag in die Rekultivierung ehemaliger Tagebaue sowie in eine „alternative“ Energieinfrastruktur für die Region investieren. Laut der investigativen Journalist*innengruppe correctiv hat die Leag kommunalen Wasserwerken Schweigegelder ausgezahlt, um Informationen über alarmierende Sulfatwerte im Trinkwasser zurückzuhalten, die auf den Braunkohleabbau in der Lausitz zurückzuführen sind.